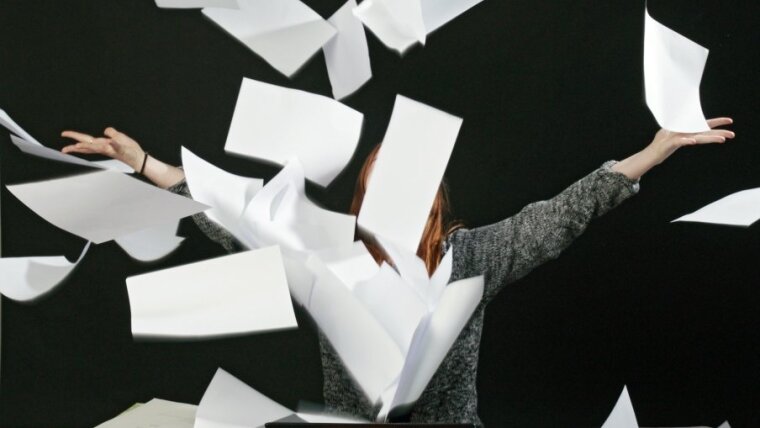
-
Beziehungsweisen. Neuaushandlungen sozialer und sozialräumlicher Distanz- und Näheverhältnisse in ihren Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt während und nach der Corona-Krise (S.Henn, S. Runkel, S. Strohschneider, M. Wermke)
Mehr erfahrenProjektleitung: Prof. Dr. Sebastian Henn, Jun.-Prof. Dr. Simon Runkel, Prof. Dr. Stefan Strohschneider, Prof. Dr. Michael Wermke
Laufzeit: 06/2020 – 05/2021
Die sich im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2/COVID-19-Pandemie hierzulande vollziehende Neuaushandlung von sozialen und sozialräumlichen Distanz- und Näheverhältnissen ist aus sozialwissenschaftlicher Perspektive von großem Interesse. So ist zu erwarten, dass die „Corona-Krise“ und die durch die Maßnahmen des „social distancing“ bzw. „physical distancing“ verursachten Veränderungen zu nachhaltigen Veränderungen der sozialen Beziehungsweisen von Menschen führen werden. Dabei ist davon auszugehen, dass Aushandlungsprozesse von sozialräumlichen Distanz- und Näheverhältnissen in unterschiedlichen sozialen Gruppen und Milieus zu je anderen Betroffenheiten und zu einer Herausforderung für die soziale Kohäsion der Gesellschaft insgesamt führen. Die verschiedenen individuellen, haushaltsbezogenen, familialen oder gruppenbezogenen Verinselungen gehen mit neuen Formen sozialer (Des)Integration einher, die sich insbesondere im affiliativen (bindungsbezogenen) Austausch zwischen Individuen, Gruppen und Milieus niederschlagen.
Vor diesem Hintergrund zielt das Projekt darauf ab, mögliche langfristige Auswirkungen dieser Neuaushandlungen von sozialer und sozialräumlicher Nähe- und Distanzverhältnisse über ein an der Delphi-Methode orientiertes Befragungsdesign nachzuzeichnen und abzuschätzen. Wir gehen von der These aus, dass die Corona-Krise und die damit verbundenen Veränderungen im persönlichen und sozialen Leben der Menschen zu nachhaltigen Veränderungen in den Beziehungen der Menschen zu ihrer Welt führen können. Wir vermuten, dass diese Aushandlungsprozesse in unterschiedlichen sozialen Milieus und Sphären jeweils anders ablaufen und zu einer Herausforderung bestehender sozialen Kohäsion der Gesellschaft hierzulande führen. Die Neuaushandlung von Distanz- und Näheverhältnissen kann zu verschiedenen Erreichbarkeiten, Differenzerfahrungen und Grenzziehungen führen, aber auch neue Formen sozialer Integration und Kohäsion aufweisen. In der Befragung von Expert*innen konzentrieren wir uns auf acht Bereiche, in denen sich Beziehungsweisen möglicherweise verändern können. Diese Bereiche sind körperliche Nähe, Übergangsriten, Gemeinschaftserlebnisse, solidarische Beziehungen, Beziehungen zwischen sozialen Kollektiven, Beziehungen im öffentlichen Raum, Vertrauen in die Demokratie und Beziehungsweisen im ökonomischen Handeln.
Im Oktober 2020 begann eine Online-Befragung mit Expert*innen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft / NGOs, Kultur und Verwaltung durchgeführt. Die Ergebnisse der Expert:innen-Befragung sollen für lokale und regionale Entscheidungsträger:innen in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Bildung, Politik, Verwaltung und Wirtschaft aufbereitet werden.
-
InDUI Innovationsindikatorik für den Doing-Using-Interacting-Mode von KMU (Uwe Cantner)
Mehr erfahren enUwe Cantner (FSU, LS Mikroökonomie)
Partner: Universität Göttingen, Universität Hannover, ifh Göttingen
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.10.2017 - 30.09.2020InDUI steht für: Innovationsindikatorik für den Doing-Using-Interacting-Mode (DUI-Mode). Der DUI-Mode ist ein Überbegriff für verschiedene Formen von Lernen und Austausch, die vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Innovationen führen. Das InDUI-Projekt erarbeitet Messungsmethoden, die diese Form der Innovationen im DUI-Mode besser abbilden als bisher und strebt eine Anwendung dieser Indikatorik in der Wirtschafts- und Innovationspolitik an.
-
Technologische Räume - Evolution, Potenziale und politische Implikationen - TechSpace (Uwe Cantner)
Mehr erfahren enPI: Uwe Cantner (FSU, LS Mikroökonomie)
Partner: Universität Hannover, Universität Bremen
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.03.2017 - 28.02.2021Erfolge von Innovationsaktivitäten, aber auch von öffentlicher Forschungsförderung werden häufig durch quantitative Outcome-Indikatoren wie Patente oder neue Produkte gemessen. Unberücksichtigt bleibt dabei meistens, ob durch Innovationen wirklich etwas Neues entsteht, definiert als eine neue Kombination von Wissensbestandteilen oder Technologien. Gerade die Diskussion zur Bedeutung von cross innovation bzw. der Innovation an Schnittstellen zwischen Technologien oder Themenbereichen hat zwar gezeigt, dass dieses Problemfeld für wichtig erachtet wird, aber bislang blieb ein Niederschlag in Indikatoren zur Messung solcher Innovationsaktivitäten aus. Speziell vor dem Hintergrund, dass mit der Hightech-Strategie spezifische Fragen und Herausforderungen der Zukunft adressiert werden sollen, erscheint eine Evaluation nicht umfassend, die nicht beachtet, welche Auswirkungen Fördermaßnahmen auf die langfristige Entwicklung von Technologien haben.
Hier setzt der vorliegende Projektantrag mit drei Schwerpunkten an: Erstens präsentiert er das Konzept der Technologieräume als neuen empirischen Ansatz zur Analyse langfristiger Technologieentwicklungen. Dazu wird im Projekt eine Reihe von Indikatoren zur Evaluation dieser Entwicklungen erarbeitet, die insbesondere der Radikalität neuer Innovationen und Technologien Beachtung schenken. Zweitens werden die erarbeiteten Indikatoren zur Identifikation der Treiber dieser Entwicklungen (mit besonderer Berücksichtigung der Technologiepolitik) genutzt. Drittens widmet sich das Projekt der Frage, welche politischen Implikationen sich aus der (pfadabhängigen) Technologieentwicklung ergeben durch exemplarische Untersuchungen zur Bedeutung und Einbettung sogenannter Basistechnologien und der Entwicklung sowie Bewertung regionaler Smart-Specialization-Strategien. -
Potentiale und Hemmnisse des Erkenntnis- und Technologietransfers am Beispiel des Innovationssystems Thüringen (Uwe Cantner)
PI: Uwe Cantner (LS Mikroökonomie)
Fördergeber: TMWWDG
Laufzeit: 01.07.2018 - 30.06.2021Das Forschungsprojekt Potentiale und Hemmnisse des Erkenntnis- und Technologietransfers im Thüringer Innovationssystem zielt darauf ab, die wesentlichen Elemente und Phasen des Technologietransfers zu erfasst, zu bewerten und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Anhand des Reallabors Thüringen werden Transferprozesse und -kanäle im Detail erforscht und Wirkungsmechanismen identifiziert. Die Erkenntnisse sollen genutzt werden um empirisch validierte Politikempfehlungen abzuleiten, die es ermöglichen, bereits vorhandene Erfolge weiter auszubauen und bestehende Defizite im Technologietransfer zu reduzieren. Dazu werden entlang des Erkenntnis- und Technologietransferprozesses Analysen durchgeführt, die es erlauben, Treiber und Hemmnisse zu identifizieren, Lösungsansätze aufzuzeigen und insgesamt den Dialog bezüglich der gesellschaftlichen und kommerziellen Verwertung von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu steigern.
-
Tech4Germany (Uwe Cantner)
Mehr erfahrenExterner LinkPI: Uwe Cantner (FSU, LS Mikroökonomik)
Fördergeber: Volkswagenstiftung
Laufzeit: 01.08.2018 - 31.07.2020Tech4Germany ist Europas erstes e-Government Summer-Fellowshipprogramm, in welchem talentierte StudentInnen und AbsolventInnen brennende e-Government Herausforderungen für die Bundesregierung lösen. Unter der Schirmherrschaft von Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun werden Fellows jedes Jahr zwischen August und Oktober in Kooperation mit dem Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) innovative Lösungen für Millionen von Bundesbürgern finden.
-
INWOK - Interkommunale Wohnflächenkonzepte als Instrument des nachhaltigen Flächenmanagements in großstädtischen Wachstumsräumen. Konzeptualisierung und Umsetzung in den Verflechtungsräumen Leipzig/Halle und Jena/Saale-Holzland-Kreis (Sebastian Henn)
Mehr erfahrenPI: Sebastian Henn (FSU, LS Wirtschaftsgeographie)
Partner: IfL für Länderkunde
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.08.2018 - 01.08.2023Ressourcenschonendes Flächenmanagement verlangt grundsätzlich nach einer intensiven Kooperation einer Vielzahl von AkteurInnen. Insbesondere bei zunehmendem Siedlungsdruck großstädtischer Kerne und ihrem unmittelbaren Umfeld erweisen sich die Abwägung verschiedener Interessen und der Austausch notwendiger Informationen zwischen den betroffenen Kommunen als zentrale Herausforderungen räumlicher Planung und Entwicklung. Dieser Problematik nimmt sich der Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie im Rahmen des Projekts INWOK an. Konkret ist vorgesehen, informations- und wissensbasierte Entscheidungsgrundlagen für ein nachhaltiges Flächenmanagement in großstädtischen Wachstumsräumen zu entwickeln und für die Übertragung in andere Räume aufzubereiten. Ausgehend von der Abgrenzung des oberzentralen Kooperationsraumes Leipzig-Halle (Saale) und entsprechender Ergänzungsstandorte, ist es Ziel der ersten Projektphase, ein abgestimmtes und umsetzungsorientiertes interkommunales Wohnflächenkonzept für den Verflechtungsraum zu erarbeiten. Dieses soll in der zweiten Projektphase auf die Region Jena/Saale-Holzland-Kreis übertragen und entsprechend angepasst werden. Der Lehrstuhl ist im Rahmen des Projekts an allen Arbeitspaketen des vom Leibniz-Institut für Länderkunde koordinierten Gesamtprojekts Interko2 beteiligt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erstellung der interkommunalen Wohnkonzepte sowie der Etablierung eines Monitoringsystems zur Erfassung ortsteilbezogener Daten verschiedener Kommunen.
-
EKOS: Entwicklung eines neuartigen Konzepts zur Sicherstellung der infektiologisch-medizinischen Versorgung von seltenen, hochkontagiösen und lebensbedrohlichen Erkrankungen in Schwerpunktkrankenhäusern (Daniela Gröschke, Stefan Strohschneider FSU, IWK)
Mehr erfahren enPI: Daniela Gröschke, Stefan Strohschneider (FSU, IWK)
Partner: Robert-Koch-Institut, div. Krankenhäuser
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.02.2017 - 01.01.2020Klimawandel, Globalisierung und Migration führen zum vermehrten Auftreten von Patienten mit seltenen, hochkontagiösen, lebensbedrohlichen Erkrankungen (HoKo-Patienten). Die Vorbereitung der Schwerpunkt-Krankenhäuser (KH) auf Ebolafieber hat gezeigt, dass sie oft nicht die technischen und fachlichen Voraussetzungen haben, HoKo-Patienten adäquat zu versorgen. Angst des Personals führte dazu, dass Verdachtsfälle nicht/inadäquat behandelt wurden. Progressive Krankheitsverläufe sowie Sekundärinfektionen wurden billigend in Kauf genommen.
EKOS hat zum Ziel, eine sichere infektiologisch-medizinische Versorgung von HoKo-Patienten in Schwerpunkt-KH zu gewährleisten. Hierzu wird ein (i) neuartiges Konzept für einen temporären Isolierbereich entwickelt, (ii) baulich-funktionelles und prozessuales Hygienemanagement konzipiert und implementiert, die Effizienz von Barrieremaßnahmen sichergestellt und (iii) Training und die Resilienz des Personals gestärkt und ein Kommunikationskonzept erarbeitet. -
SAWAB: Sozialwissenschaftliche Betrachtung verschiedener Aspekte der Warnung der Bevölkerung (Stefan Strohschneider, Gesine Hofinger)
Mehr erfahrenExterner LinkPI: Stefan Strohschneider, Gesine Hofinger (FSU, IWK)
Fördergeber: BBK
Laufzeit: 01.12.2017 - 01.11.2019Das Projekt erforscht psychologische und soziale Prozesse bei der Rezeption und Umsetzung von Warnungen der Bevölkerung in verschiedenenen Szenarien. Inhalte und Strukturen von Warntexten werden im Zusammenhang mit der Nutzung technischer Warnmittel untersucht. Es findet eine Triangulation verschiedener Forschungsmethoden statt. Der Ist-Zustand amtlich vorbereiteter Warnungen für verschiedene Szenarien sowie die Einschätzung von deren Verständlichkeit und Umsetzbarkeit werden erhoben. In einer quantitativen Erhebung werden die Informationsbedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen szenarienspezifisch erfasst. Das Verständnis und die Glaubwürdigkeit ausgewählter Warnungen werden in Experimenten mit heterogenen Stirchproben überprüft, optimiert und anschließend experimentell evaluiert. Aus den Ergebnissen werden Rahmenempfehlungen für Behörden und Akteure des Bevölkerungsschutzes abgeleitet.
-
Verhältnismäßigkeit als Schranke unkonventioneller Geldpolitik (Christoph Ohler)
Mehr erfahrenExterner LinkPI: Christoph Ohler (FSU, LS Öffentliches Recht)
Fördergeber: DFG
Laufzeit: 01.04.2018 - 31.03.2021Gegenstand des Forschungsprojektes ist die Frage, welche Grenzen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der sog. unkonventionellen Geldpolitik der EZB zieht.
-
PAIRFAM Beziehungs- und Familenpanel (Franz J. Neyer)
Mehr erfahrenExterner LinkPI: Franz J. Neyer (FSU, LS Persönlichkeitspsychologie)
Partner: Universität Bremen, Universität Köln, LMU München
Fördergeber: DFG
Laufzeit: 2008 - 2022Das Beziehungs- und Familienpanel "pairfam" stellt der Fachöffentlichkeit als sozialwissenschaftliche Infrastruktur umfangreiche Daten für die Analyse von individuellen Entscheidungsprozessen und langfristigen Entwicklungen in den Bereichen Partnerschaft und Familie in Deutschland zur Verfügung. Anhand der pairfam-Daten sind individuale und dyadische Längsschnitts-Analysen zu Themen wie etwa Partnerwahl, Partnerschaftsentwicklung, Entscheidungsfindung bzgl. Elternschaft, Betreuungsarrangements in unterschiedlichen Familienkonstellationen und Generationenbeziehungen möglich. Die Daten werden in einer jährlichen Befragung von Ankerpersonen und deren Familienangehörigen erhoben und in einem umfangreich in englischer und deutscher Sprache dokumentierten Scientific-Use-File jeweils ein Jahr nach Ende jeder Erhebungswelle veröffentlicht. Webbasierte Informationsangebote, individuelle Beratung, Schulungsveranstaltungen und Nutzerkonferenzen gewährleisten eine effiziente Verbreitung und Nutzung der Daten. Seit Beginn der Laufzeit des Panels 2008 haben sich mehr als 1.700 Forscher/innen aus dem In- und Ausland als Datennutzer registriert und es sind mehr als 200 Fachpublikationen auf Basis der pairfam-Daten entstanden. Mit diesem Fortsetzungsantrag im DFG-Langfristprogramm wird die Fortführung von pairfam für weitere zwei Jahre (Wellen 11 und 12) sowie eine Aufstockung der Stichprobe (d.h. eine Ergänzung der bestehenden Kohorten sowie die Ziehung einer neuen Kohorte der Geburtenjahrgänge 2001-2003) in Welle 11 beantragt. Die beiden zusätzlichen Wellen sowie die Aufstockung werden den Wert der Daten für die Forschung in mehrerlei Hinsicht steigern: 1. Mit den zusätzlichen Wellen und den zusätzlichen Beobachtungen durch die Aufstockung steigt die Zahl bedeutsamer, aber selten vorkommender Ereignisse wie Scheidung, Entstehung von Stieffamilien und ähnlichem. 2. Erst die Beobachtung über längere Zeiträume ermöglicht die Evaluation von politischen Maßnahmen, die in den Erhebungszeitraum fallen (z.B. Betreuungsgeld). 3. Für die lückenlose Analyse von Alters-Trajektorien ist eine gewisse Überlappung der drei (jeweils 10 Jahre Differenz aufweisenden) Kohorten wertvoll. 4. Die durch die Aufstockung zusätzlichen Fälle erlauben die Differenzierung von Alters- und Kohorteneffekten (so sind sowohl Vergleiche innerhalb einer Kohorte über die Zeit als auch zwischen den Kohorten möglich). 5. Durch den Vergleich der neu gezogenen Kohorte mit den Daten der bestehenden jüngsten Kohorte von vor 10 Jahren kann gesellschaftlicher Wandel bezüglich der Einstellungen und Entscheidungen junger Menschen optimal untersucht werden.6. Die Ergänzung der bestehenden Kohorten durch die Aufstockung gleicht Verzerrungen der Stichprobe durch selektive Teilnahme aus.7. Die Aufstockung ist kosteneffizient, da Anfangskosten wie die Fragebogenentwicklung oder Etablierung von Prozessen der Datenaufbereitung nicht mehr anfallen und das Projekt in den Händen eines erfahrenen Teams liegt.
-
Language-Skill Investments and Migration Decisions (Silke Übelmesser)
Mehr erfahrenExterner LinkPI: Silke Übelmesser (FSU, LS Finanzwissenschaften)
Partner: ifo Institut München (Panu Poutvaara, Till Nikolka)
Fördergeber: DFG
Laufzeit: 01.02.2018 - 31.05.2020Migration has become an increasingly important aspect of globalization over the last decades. A factor which is likely to be important for most migrants is language skills. Empirical research in the area of language and migration is, however, constrained by the scarcity of high-quality data, in particular individual level information on pre-migration language learning, language skills and migration intentions.
For this, we will conduct surveys among participants of language courses offered by the Goethe-Institut which is an important provider of German language courses abroad. Surveys among university students will complement these surveys. The data will contain individual level information on migration intentions and previous migration experience as well as on language learning, including the reasons of learning or not learning, and on the level of existing language skills. Furthermore, there will be detailed information on the socio-economic background, in particular the level of education and the type of qualification.
The data will be used to investigate the reasons of language learning in the home country and its determinants as well as the relationship between migration intentions on the one side and language skills on the other side. Furthermore, the link between migration and the international applicability of acquired education will be studied and, in addition, there will be an analysis of language-skill investments in the presence of potentially gender-specific migration incentives. -
WOM – Weltoffen miteinander arbeiten in Thüringen. Maßnahmen zur Steigerung der personalpolitischen Zukunftsfähigkeit Thüringer Unternehmen. (Silke Übelmesser, Sebastan Henn)
Mehr erfahrenPI: Sebastian Henn (FSU, LS Wirtschaftsgeographie), Silke Übelmesser (FSU, LS Finanzwissenschaften), Jürgen Bolten (FSU, LS Interkulturelle Wirtschaftskommunikation)
Fördergeber: ESF
Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2021Die wirtschaftliche Situation Thüringens ist seit geraumer Zeit durch einen sich kontinuierlich verschärfenden Fachkräftemangel gekennzeichnet. Seine Überwindung setzt immer stärker eine aktive Anwerbung internationaler Fachkräfte voraus, da die endogenen Arbeitsmarktpotenziale inzwischen weitgehend ausgeschöpft sind. Dies stellt insofern eine erhebliche Herausforderung dar, als die Vorbehalte gegenüber internationalen Mitbürgern in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben: Aktuell vertritt etwa ein Drittel der Thüringer trotz der tatsächlich sehr geringen Ausländerquote die Ansicht, eine deutliche „Überfremdung“ im Freistaat wahrzunehmen. Dies impliziert, dass von erheblichen Ressentiments auch gegenüber internationalen Fachkräften auszugehen ist. Der ungelöste Widerspruch zwischen dem erheblichen Bedarf an internationalen Fachkräften einerseits und den erstarkenden Ressentiments ihnen gegenüber andererseits ist imstande, die wirtschaftliche Entwicklung der thüringischen Unternehmen mittel- bis langfristig erheblich zu beeinträchtigen. Das Projekt hat vor diesem Hintergrund zum Ziel, geeignete Maßnahmen zu identifizieren und Lösungen auszuarbeiten, die der Überwindung dieser Ressentiments dienen. Konkret gilt es, (a) eine detaillierte empirische Bestandsaufnahme regional- und akteursspezifischer Einstellungen und Verhaltensweisen durchzuführen sowie (b) konkrete Maßnahmen in und mit Thüringer Unternehmen (Einführung von Onboarding-Strukturen, interkulturelle Diversity-Trainings, Wissenskommunikation etc.) zu konzeptualisieren und umzusetzen, die ihrerseits von thüringenweiten Kommunikationskampagnen zur Überwindung der Ressentiment begleitet werden.
Das interdisziplinäre Projekt vereint die Expertise der Lehrstühle für Finanzwissenschaft, Wirtschaftsgeographie und Interkultureller Wirtschaftskommunikation der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena. Seine Ergebnisse können nach Ablauf der Förderung selbstständig fortgeschrieben werden. Darüber hinaus finden die Ergebnisse des Projekts Eingang in wissenschaftliche Fachdiskussionen und die universitäre Lehre. Die Projektqualität wird durch die beteiligten WissenschaftlerInnen und regelmäßige Reflexionen mit Stakeholdern sichergestellt. Das Projektmanagement wird durch die Verwaltung der FSU mit ihrer langjährigen Projekterfahrung unterstützt.
-
Crowdfunding: ein alternatives Finanzierungsinstrument für Gründer und Kreative? (Tobias Regner)
PI: Tobias Regner (LS für Empirische und Experimentelle Wirtschaftsforschung)
Fördergeber: DFG
Laufzeit: 01.10.2016 - 31.12.2019Das Projekt analysiert den Markt für Gründerfinanzierung. Ein besonderer
Fokus des Projekts ist Crowdfunding, eine Alternative zu traditionellen
Finanzierern wie Banken oder Venture Capital. Crowdfunding ist ein sehr
junges Phänomen und ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Es
hat das Potential, das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage im
Markt für Gründer- bzw. Kreativenfinanzierung zu verbessern. Die
Beziehung zwischen Gründern/Kreativen, die Kapital benötigen, und
externen Geldgebern wird beeinträchtigt durch Informationsasymmetrien
bezüglich des Projekts des Gründers. Effizienzverluste sind die Folge,
da Projekte keine Förderung finden, weil Intermediäre nicht in der Lage
sind, die Gründer bzw. deren Projekte effektiv zu evaluieren. Im
Gegensatz zu den traditionellen Finanzierern erlaubt Crowdfunding es,
eine direkte Förderentscheidung zu treffen. Die "Crowd" (die Masse der
Individuen) stellt dem Entrepreneur finanzielle Ressourcen zur Verfügung
und erhält im Gegenzug Firmenanteile, Zinszahlungen, das zukünftige
Produkt/Service oder eine nicht-monetäre Auszeichnung. Was genau macht
Crowdfunding interessant? Es bringt neue Akteure (Crowdfunder) zur
Angebotseite des Markts für Gründerfinanzierung und es ermöglicht die
direkte Interaktion zwischen Gründer und Crowdfunder. Zumindest
teilweise findet diese Interaktion innovativ statt.
Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, herauszufinden, warum
Crowdfunding erfolgreich ist, wann es gut/schlecht funktioniert, und wie
es eventuell noch besser funktionieren kann. Das Projekt versucht
insbesondere Antworten auf die folgenden Fragen zu finden: Was motiviert
Individuen, ein Crowdfunding Projekt zu unterstützen? Kann Crowdfunding
effektiver sein als alternative Finanzierungsmöglichkeiten? Welche
Designinstrumente könnten Crowdfunding verbessern? Zu diesem Zweck
besteht das Projekt aus unterschiedlichen methodischen Teilen. Die
empirische Analyse von Felddaten von Crowdfunding Plattformen
erleichtert die Identifikation von allgemeinen Verhaltensmustern.
Allerdings ist sie auf deskriptive und korrelative Aussagen beschränkt.
Das kontrollierte Umfeld im Labor erlaubt hingegen das Testen von
kausalen Beziehungen und den Fokus auf spezifische Aspekte. -
Verständnis und Haltungen zur Altersvorsorge in Deutschland: Ausprägungen und Auswirkungen auf vorsorgebezogenes Verhalten (VHAlt) (Silke Übelmesser)
Mehr erfahren enPI: Silke Übelmesser (Lehrstuhl für Finanzwissenschaften)
Partner: Universität Mannheim
Fördergeber: BMAS
Laufzeit: 01.09.2019 – 31.8.2022Der demographische Wandel hat Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies stellt einerseits eine Herausforderung für sozialpolitische Entscheidungsträger dar, da sie die erforderlichen Anpassungen adäquat kommunizieren und die Betroffenen von deren Sinnhaftigkeit überzeugen müssen. Andererseits gehen die Entwicklungen mit steigenden Anforderungen an die Erwerbsbevölkerung einher, denn die daraus resultierende stärkere Selbstverantwortung bei der Altersvorsorge erfolgt in einem Umfeld zunehmender Unsicherheit. Zur Lösung dieser Problematik wird u.a. eine Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung, der so genannten Financial Literacy, gefordert.
Beide Aspekte – Kommunikation bzw. Information und Financial Literacy - sollen zu gewünschten Verhaltensänderungen (Akzeptanz von Reformen, Engagement bei anderen Formen der Altersvorsorge) führen. Hierfür werden jedoch Kenntnisse darüber benötigt, ob und inwieweit die Bürger/innen das System der Altersvorsorge überhaupt adäquat verstehen. Die Bedeutung, die das Verständnis (bzw. Missverständnis) eines bestimmten Inhaltsbereichs für Meinungsbildung und Verhalten hat, wird durch Untersuchungen aus anderen Forschungsgebieten untermauert. Für den Bereich der Altersvorsorge liegen jedoch keine Befunde vor. Das Projekt möchte zur Schließung dieser Forschungslücke beitragen. Insbesondere werden die folgenden, zentralen sozialpolitischen Forschungsfragen untersucht: (1) Welches (Miss-)Verständnis und welche Haltungen zum Thema Altersvorsorge liegen in Deutschland vor? (2) Variieren (Miss-)Verständnis und Haltungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen? (3) Lassen sich zwischen (Miss-)Verständnis, Haltungen und Verhaltensweisen im Kontext der Altersvorsorge kausale Beziehungen (Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge) ermitteln? (4) Welche Handlungsempfehlungen lassen sich ableiten und durch die Entwicklung von Kommunikationsempfehlungen und exemplarischen Lerneinheiten unterstützen?
-
Herrenhausen Konferenz: The New Role of the State for the Emergence and Diffusion of Innovation (Uwe Cantner)
PI: Uwe Cantner (FSU, chair for microeconomics)
partner: University of Bremen, University of Twente
Funding: Volkswagenstiftung
Date: 20.-22.02.2019The role of the state and of governments in knowledge societies for the stimulation, regulation and diffusion of innovation has been debated in politics and various social sciences for years, certainly in times of economic crisis. Current discussions include the question whether and how state-related actors and agencies can address Grand Societal Challenges and Sustainable Development Goals worldwide: climate and environmental threats, natural resource scarcities, increasing levels of inequality and exclusion and the challenges of the digitalization and robotization of our lives, to name a few. The search for effective approaches of addressing these problems with the help of innovation cannot escape the old debate on state versus market or on centralized versus decentralized planning or on autocratic versus democratic decision making. At the same time, we need to reflect on what we mean by state and statehood in the 21st Century as well as new state dimensions such as new publicness, like in the sharing economy. This crucial debate deserves a broader platform, the international Herrenhausen conference on February 20-22, 2019.
-
Büromarktbericht (Sebastian Henn)
PI: Sebastian Henn (FSU, LS Wirtschaftsgeographie)
Fördergeber: Stadt Jena
Laufzeit: 01.12.2017 - 01.07.2018Die anhaltende Nachfrage nach aktuellen und verlässlichen büroflächenmarktrelevanten Daten, insbesondere über die räumliche und zeitliche Entwicklung des Büroflächenbestandes, sowie die kontinuierliche Veränderung von Angebot und Nachfrage machen ein Monitoring des Marktes erforderlich. Die in diesem Zusammenhang zu erhebenden Daten spielen für Investoren und an der Standortentwicklung beteiligte Akteure eine zentrale Rolle, da sie es gestatten, Investitionsentscheidungen fundiert zu treffen bzw. zukünftige Bedarfe besser abzuschätzen. Die im Rahmen des Forschungsprojekts "Büromarkt Jena: Status-Quo und Dynamik" sowie dessen Fortschreibung (11/2016 bis 07/2017) generierte Datenbasis gilt es im Rahmen dieses Nachfolgeprojekts fortzuschreiben und weiter auszubauen. Konkret sind in diesem Zusammenhang u. a. Kartierungen ausgewählter Stadtteile sowie Befragungen der auf dem Jenaer Immobilienakteur tätigen Akteure vorgesehen.
-
difo:stadt Digital unterstütze und animierende Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen des nachhaltigen Flächenmanagements und der Ressourceneffizienz am Beispiel der Modelkommune Jena (Sebastian Henn)
PI: Sebastian Henn (FSU, LS Wirtschaftgeographie)
Partner: iginiti GmbH, JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH, quaas_stadtplaner
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.01.2017 - 01.12.2018difo:stadt hat zum Ziel, eine internetbasierte Schnittstelle zu entwickeln, mit deren Hilfe es möglich ist, Daten zu Planungs- und Entwicklungsvorhaben so aufzubereiten und zu visualisieren, dass auch Laien in die Lage versetzt werden, sich umfassend über stadtplanerische Aspekte zu informieren und im Rahmen von Verfahren der Bürgerbeteiligung verstärkt an den Planungsprozessen teilzuhaben. Gegenstand des vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der Friedrich-Schiller-Universität koordinierten Teilprojekts (TP 4) ist es in diesem Zusammenhang, das soziale und technische Umfeld der angestrebten technischen Lösung näher zu analysieren. Konkret werden zu diesem Zweck die Anforderungen potenzieller Nutzer an eine solche Lösung bzw. die tatsächliche Zufriedenheit der Nutzer mit der im Projekt entwickelten Pilotanwendung erhoben. Darüber hinaus gilt es, bereits ähnliche, bereits existierende Produkte im Hinblick auf ihren Funktionsumfang zu analysieren und mögliche Preismodelle und Vertriebskanäle der von den Projektpartnern erarbeiteten Lösung zu eruieren. Die Datengewinnung im Projekt stützt sich auf den Einsatz leitfadengestützter Experteninterviews und standardisierter schriftlicher Befragungen. Die Ergebnisse des Projekts sollen in praxisorientierten und wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden und darüber hinaus auch in die universitäre Lehre einfließen.
-
INVOLVE: INitiate VOLunteerism to counter VulnErability (Stefan Strohschneider)
PI: Stefan Strohschneider (FSU, IWK)
Partner: FU Berlin, DRK, NIAS Bangalore
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.04.2015 - 01.12.2018Das Forschungsprojekt INVOLVE untersucht die Katastrophenanfälligkeit und Bewältigungskapazitäten der Bevölkerung sowie freiwilliges Engagement im Kontext des Katastrophenmanagements kulturvergleichend in Deutschland und Indien.
Anhand verschiedener Szenarien werden einerseits differenzierte Hilfebedarfe innerhalb der Bevölkerung identifiziert und andererseits die Motivation freiwilliger Helferinnen und Helfer im Kontext der Katastrophenvorsorge und -bewältigung analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen einer abgestimmten Entwicklung, Evaluierung und Verbesserung von Strategien und Trainings für Organisationen im Katastrophenschutz mit besonderer Berücksichtigung des DRK-Betreuungsdienstes. Dabei werden die beteiligten Akteure in allen Phasen des Projektes in den Forschungsprozess einbezogen. -
Instrumente und Wirkung der Außenwirtschaftsförderung in Afrika (Andreas Freytag)
Mehr erfahrenPI: Andreas Freytag (FSU, LS Wirtschaftspolitik)
Partner: Gabriel Felbermayr (CESifo), Erdal Yalcin (CESifo)
Fördergeber: KfW/DEG
Laufzeit: 15.11.2018 - 30.04.2019Afrika hat großes wirtschaftliches Wachstumspotenzial. Zugleich weisen sehr viele Länder nach wie vor einen hohen Entwicklungsbedarf auf. Für diese Entwicklung sind privatwirtschaftliche Investitionen zentral. Hierbei können ausländische Unternehmen eine positive Rolle spielen. Sowohl die deutsche Wirtschaft als auch die Bundesregierung sind an einem stärkeren Engagement deutscher Unternehmen in Afrika interessiert. Allerdings behindern die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen häufig diese Investitionspläne. Besonders betroffen sind hiervon mittelständische Unternehmen. Daher soll die Studie ihr Hauptaugenmerk auf außenwirtschaftliche Förderinstrumente legen, mittels derer es der Staat den Unternehmen erleichtern kann, in afrikanischen Ländern zu investieren.
-
HiTh - Hochqualifiziert. International. Thüringen (Silke Übelmesser, Sebastian Henn)
Mehr erfahrenExterner LinkPI: Silke Übelmesser (FSU, LS Finanzwissenschaften), Sebastian Henn (FSU, LS Wirtschaftsgeographie)
Partner: Internationales Büro der FSU
Fördergeber: ESF
Laufzeit: 01.06.2016 - 31.05.2019Prognosen zufolge wird die Bevölkerung in Thüringen in den nächsten Jahrzehnten stark abnehmen. Damit verbunden ist ein massiver Rückgang des Fachkräftepotenzials, der den Wirtschaftsstandort Thüringen mittel- bis langfristig vor erhebliche Herausforderungen stellt. Mit dem Ziel, diesen Entwicklungen über die Erschließung exogener Potenziale entgegenzuwirken, strebt das Projekt eine Verbesserung der Aufnahmefähigkeit Thüringer Unternehmen für internationale Studierende/Absolventen und Fachkräfte an. Die Unterziele des Projekts umfassen:
(1) Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Aufnahmefähigkeit und Bindungskraft Thüringer Unternehmen für internationale Studierende und Fachkräfte. Dazu zählen die Vermittlung internationaler Studierender in die Thüringer Wirtschaft im Rahmen von Praktika sowie ein Wettbewerb um die besten Unternehmenskonzepte für die interkulturelle Öffnung der Unternehmen und deren Umsetzung.
(2) Generierung einer umfassenden Datenbasis durch Befragungen von internationalen Studierenden und ArbeitnehmerInnen sowie der Thüringer Hochschulen und Unternehmen.
(3) Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Thüringer Wirtschaft, Politik und Hochschulen und Kommunikation über unterschiedliche Kanäle für einen umfassenden Transfer der Ergebnisse zu den Beteiligten und Betroffenen und die breite Öffentlichkeit.
Das Projekt wird gemeinsam durchgeführt von den Lehrstühlen für Allgemeine Volkswirtschaftslehre/Finanzwissenschaft und für Wirtschaftsgeographie, dem Internationalen Büro der Friedrich-Schiller-Universität Jena und einer wirtschaftsnahen Fördereinrichtung. Als Projektergebnisse werden u.a. die erfolgreiche Vermittlung von 30 Praktikanten, die Vergabe eines Unternehmenspreises für interkulturelle Öffnung, die Erstellung einer Broschüre/eines Flyers und von wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie die Verstetigung der Projektstrukturen erwartet. Die Projektqualität wird über die Einhaltung wissenschaftlicher Standards durch die am Projekt beteiligten WissenschaftlerInnen, den regelmäßigen Austausch zwischen den Projektpartnern sowie die damit mögliche kontinuierliche Reflexion der bereits erreichten Ergebnisse sichergestellt. Ferner unterstützt die Verwaltung der FSU mit ihrer langjährigen Projekterfahrung das Projektmanagement. -
Organisation des Sicherheitsmarktes (Andreas Freytag)
Mehr erfahrenExterner LinkOrganisation des Sicherheitsmarktes (Andreas Freytag)
PI: Andreas Freytag (FSU, LS Wirtschaftspolitik)
Partner: BIGS u.a.
Fördergeber: BMBF
Laufzeit: 01.11.2018 - 31.08.2019In dem Verbundvorhaben Die Ordnung des Sicherheitsmarktes (OSiMa) wurde analysiert, welche Formen von Schutzleistungen bestehen, und wie diese organisiert und finanziert werden. Dabei ging es insbesondere darum, darzulegen, welchen Beitrag aus ordnungspolitischer Sicht die private Sicherheitswirtschaft leisten kann. Ziel war es, den Rahmen zu beschreiben, innerhalb dessen neue Dienstleistungen und Organisationsformen von Schutz und Sicherheit durch die Sicherheitswirtschaft entstehen können. Gleichzeitig wird eine systematische Abgrenzung von Schutzleistungen und Aufgabenbereichen ermöglicht, die aufgrund juristischer, verwaltungswissenschaftlicher, technischer, volks- oder betriebswirtschaftlicher Erwägungen in staatlicher Hand zu bleiben haben oder bleiben sollten.
-
Humangeographische Forschungsperspektiven nach dem practice turn in den Sozialwissenschaften (Susann Schäfer)
Mehr erfahrenPI: Susann Schäfer (FSU, LS Wirtschaftsgeographie)
Fördergeber: DFG
Laufzeit: 01.09.2016 - 01.08.2019Mit seiner 1996 veröffentlichten Theorie der sozialen Praktiken setzt Theodore Schatzki neue und relevante Impulse für die Konzeptionen sozialen Handelns in den Sozialwissenschaften. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen nach der Konstitution des Sozialen und nach Verflechtung individueller Handlungsweisen mit übergeordneten sozialen Phänomenen.
Zentrale Konzepte in Schatzkis Theorie sind zum einen "Praktiken-Arrangement-Bündel", die verstärkt das Materielle für die Konstitution des Sozialen berücksichtigen, und zum anderen der "Zeit-Raum" sozialer Praktiken. Eine Analyse der Orchestrierung von Zeit, Raum und Praktiken und deren Verdichtung zu "place-path-arrays" ist der daraus folgende Auftrag für empirische Forschung. Der Zweck des Forschungsnetzwerks ist die Bündelung solcher praktikentheoretischer Forschung unter deutschsprachigen Humangeographen mit dem Ziel theoretische und methodologische Themen zu diskutieren und diese für die humangeographische Forschung weiterzuentwickeln. An dem Forschungsnetzwerk nehmen Wissenschaftlern unterschiedlicher humangeographischer Ausrichtung teil, die anhand von drei Querschnittsthemen (politische Praktiken, Praktiken der wirtschaftlichen Transformation und des Marktes, Praktiken des Konsums) die Theorie der sozialen Praktiken aufarbeiten und den von ihnen bearbeiteten Forschungsthemen neue Impulse zuführen wollen.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen auf dem Deutschen Kongress für Geographie 2017 mit handlungs- und praxisinteressierten GeographInnen diskutiert werden. Der Erkenntnisgewinn aus der dreijährigen Kooperation soll in gemeinsamen Themenheften und einem Handbuch zu "Praktiken und Raum" festgehalten werden.